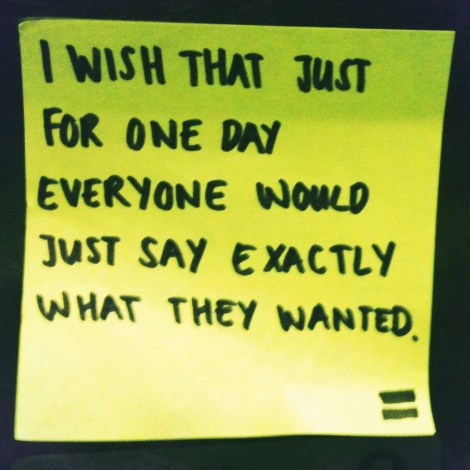Ein Wort. Und noch ein Wort. Schon sind es zehn. Doch schreibe ich nicht um der Wörter willen. Auch nicht um der Zahlen. Ich schreibe, weil ich schreiben kann. Weil die Wörter in mir hocken, auf Bänken, wie Kinder in der Umkleide vor der Turnhalle. Sie tuscheln und warten auf den Anpfiff. Nun stehen sie auf und drängen in die Halle, rennen wild durcheinander und wollen so gar nicht ruhig stehen. Wollen sich so gar nicht in Reihen stellen, wollen nicht gezählt, wollen nicht betrachtet und wollen schon gar nicht geordnet und trainiert werden. Sie wollen einfach nur sein. Manche zerfallen in ihre Einzelzeile. Buchstaben liegen herum und ich, die Turnlehrerin wider Willen, habe keine Ahnung, wie ich dieses Chaos da … ja, was … wie ich dieses Chaos, so es denn eins ist, zähmen soll? Lässt sich zähmen, was wild sein will? Kann Chaos denn etwas anderes als Chaos sein und wenn ja, wozu? War Chaos nicht der Anfang von allem, was ist? Chaos als Quelle. Chaos als Kraft. Chaos als Neuanfang? Wozu auch immer.
Da stehe ich also und betrachte die Wörter, betrachte die Buchstaben und lasse sie gewähren. Alle sind sie da. Das Wörterbuch hat sich geöffnet. Sinn kommt auf mich zu und fragt, ob er mir helfen soll. Ich schaue ihn an, klein und schmächtig ist er, trägt eine Brille und schaut mit einem Blick, der so gar nicht zu seiner geringen Größe passen will, an mir vorbei. Nein, nicht an mir vorbei. Durch mich durch. Er durchschaut mich, er weiß, dass ich wortlos bin. Ich als einzige bin die ohne Worte. Bin weder Wort noch Buchstabe. Bin einfach nur Mensch. Eine, die sich mit Wörtern verbinden, mit Wörtern verbünden will, um zu verstehen. Das ist es, was ich will. Ihr Wörter, sage ich, ich will verstehen. Ja, Sinn, du kannst mir helfen. Wenn du das denn kannst. Ich will dich und deine vielen Geschwister hier verstehen. Nein, nicht euch, aber das, wofür ihr steht. Komm doch mal her, du da. Wie heißt du denn? Schüchtern kommt sie einen Schritt näher und flüstert ihren Namen. Ich habe sie nicht verstanden. Sinn souffliert: Liebe. Das ist Liebe. Sie mag aber ihren Namen nicht. Die Menschen lachen oft über sie. Und sie mag es nicht, dass alle Menschen zu wissen glauben, wer sie ist und wofür sie steht und in Wirklichkeit ist alles ganz anders.
Wie anders?, frage ich und bereue meine Frage bereits. Sinn lächelt traurig. Liebe kann man nicht erklären, Liebe kann man nur lieben. Sie ist rot geworden, die Kleine. Ich kann mir nicht helfen, ich möchte sie einfach nur in den Arm nehmen und tue das auch. Sinn lächelt. Ja, sagt er.
 Weisheit ist groß und hat ihre Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und ich weiß nicht, ob sie eine Sie oder er ein Er ist. Er sagt: Lass zu. Hör damit auf, zu wollen. Zu machen, zu müssen. Ich setze mich auf den Boden. Die Wörterfamilie sammelt sich um mich. Und auf einmal sind alle ruhig und wir sind uns ganz nah.
Weisheit ist groß und hat ihre Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und ich weiß nicht, ob sie eine Sie oder er ein Er ist. Er sagt: Lass zu. Hör damit auf, zu wollen. Zu machen, zu müssen. Ich setze mich auf den Boden. Die Wörterfamilie sammelt sich um mich. Und auf einmal sind alle ruhig und wir sind uns ganz nah.
Geschichte erzählt mir, wie es in der Welt der Wörter zugeht. Ich begreife, dass die Wörter mehr verstehen von Demokratie, von Eigenmacht und von Kameradschaft. Manche Wörter erzählen mir, wie sie missbraucht werden. Macht stehen die Tränen in den Augen. Ich war nicht immer so, so traurig, so negativ besetzt, sagt sie. Sie ist erstaunlich schön, Frau Macht. Aber erst, wenn man genau hinsieht. Ich bin ein Missbrauchsopfer, aber diese Rolle ist einfach nur zum Kotzen. Und am liebsten will ich nicht mehr leben. Oder dann möchte ich wenigstens, wie das Menschen können, in eine Art Zeugenschutzprogramm für missbrauchte Wörter eintreten und an einem neuen Ort neu anfangen. Andererseits, wenn ich weggehe, werden sich die Menschen einfach ein anderes Wort nehmen, dass sie an meiner Stelle missbrauchen können um ihre Gier auszuleben.
Gier, ein kleiner blonder Bursche, sagt, dass er amputiert worden sei. Das Neu habe man ihm weggenommen und ihn schon als Kind von seinem Bruder Neugier getrennt. Aber im Herzen drin hoffe er noch immer auf ein Umdenken. An ihm solle es nicht liegen. Er würde sich gerne deleten lassen, wenn es der Menschheit diene.
Gewaltig, ein erstaunlich drahtiger kleiner Kerl, flüstert, dass er früher ein gutes Wort gewesen sei. Aber heute – er verdreht die Augen – heute assoziieren mich viele mit Gewalt. Aber ich, sagt Gewalt, ich bin auch nicht böse. Ursprünglich stand ich für die Kraft der Erde, die sich zuweilen schüttelt, um zu zeigen, wer das letzte Wort hat.