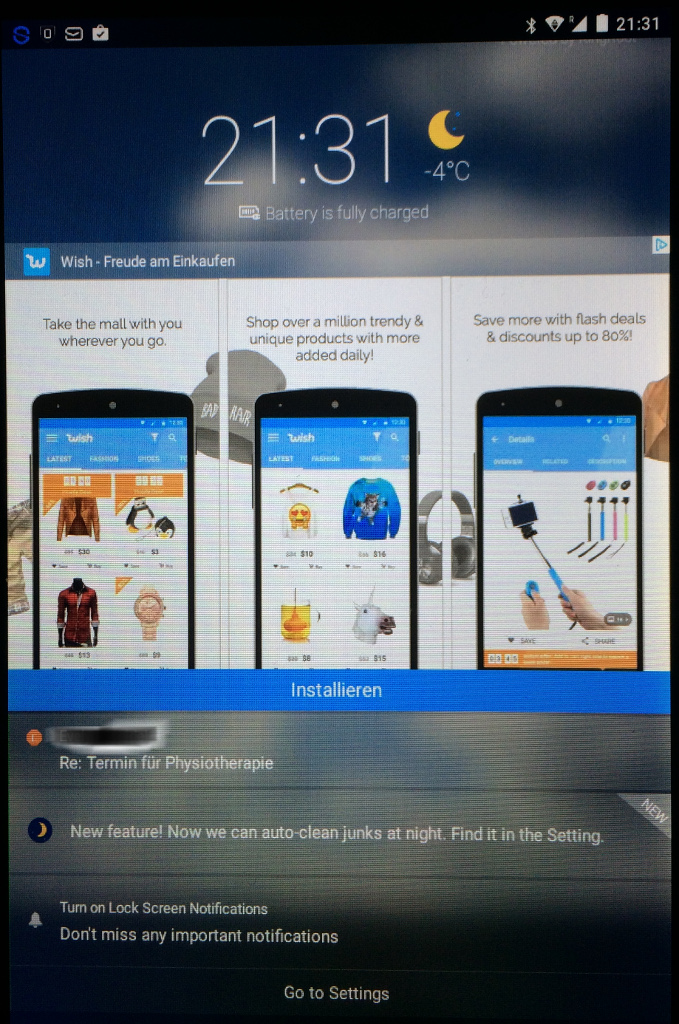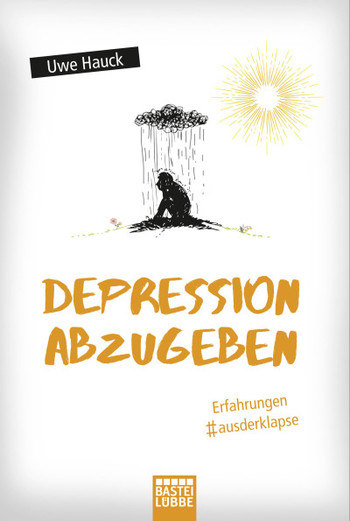Vor etwas über drei Jahren habe ich meine erste Buchrezension über ein Buch zum Thema Depressionen gebloggt. Kathrin Weßling hat mich damals mit ihrem biografisch eingefärbten Roman Drüberleben mehr als nur tief berührt. Auf hohem literarischem Niveau erzählt sie in Romanform über eigene Erfahrungen. Doch es muss kein Roman sein, denn über erlebtes Leid zu schreiben, über Depression zu schreiben, wirkt zum einen selbsttherapeutisch zum andern ziehen auch andere Menschen – Betroffene ebenso wie Interessierte – heilsamen Nutzen aus solchen Büchern.
Depression ist noch immer eine Krankheit, die nur bedingt heilbar ist und oft freitödlich endet, obwohl die Möglichkeiten, Depressionen zu therapieren, gewachsen sind. Depression ist eine Art Krebsgeschwür, das in der Seele wuchert – oft heilbar, manchmal auch nicht – und darum ist es wichtig, darüber zu sprechen, zu schreiben, zu lesen. Für Betroffene, um ernst genommen zu werden und mehr Lebensqualität zu finden; für Nichtbetroffene, um besser zu verstehen.
Auch die Möglichkeiten, sich über Depression auszutauschen, sind dank sozialer Medien gewachsen. Zum Beispiel auf Twitter. Mit Hashtags, also Schlagwörtern, wie #notjustsad oder #ausderklapse.
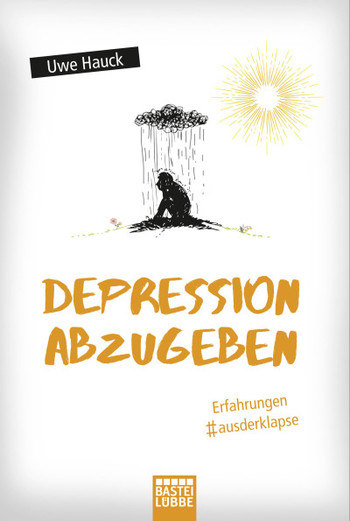 Den zweiten dieser beiden Hashtags hat Uwe Hauck kreiert, als er sich nach seinem Suizidversuch vor bald zwei Jahren entschied, mit Hilfe von Klinikaufenthalten den Weg zurück ins Leben zu wagen. Zu twittern, so schreibt er wiederholt, sei Teil seiner Therapie gewesen.
Den zweiten dieser beiden Hashtags hat Uwe Hauck kreiert, als er sich nach seinem Suizidversuch vor bald zwei Jahren entschied, mit Hilfe von Klinikaufenthalten den Weg zurück ins Leben zu wagen. Zu twittern, so schreibt er wiederholt, sei Teil seiner Therapie gewesen.
Gleich zu Anfang seines sehr persönlichen Erfahrungsberichtes stellt er seinen erfolglosen Versuch, sich das Leben zu nehmen. In Rückblenden zeigt er uns, wie es soweit kommen konnte. Dabei taucht er mit uns Lesenden sowohl in seine Kindheit als auch in sein berufliches Umfeld ein.
Als ebenfalls von der Krankheit Betroffene beeindruckt es mich, ihm bei seinem rasanten Wechsel der Perspektiven zuzuschauen. Damit meine ich weniger seine Sprünge auf der Zeitachse als die Erzählperspektiven, die er fliegend wechselt. Eben noch der rational denkende Mensch, der sich selbst analysiert, versteht, auswertet, taucht er unvermittelt in Grauzonen ein, in diesen Raum zwischen rationaler Auswertung einer Situation und emotionaler Bewertung und Beurteilung derselben. Oft genug Verurteilung. Blitzartig wachsen aus Selbstverurteilung düstere Wahrnehmungen, Interpretationen, Misstrauen, die in von Schmerz gesteuerte Gedanken, Worte und Handlungen münden. Hoffnungslosigkeit und Hoffnung auf der gleichen Schaukel, mal die eine oben, mal die andere.
Wir erleben an seiner Seite mit, wie er zuerst in der geschlossenen, später in der offenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik den Weg zurück in einen lebbaren Alltag angeht, unterstützt von seiner Frau und seinen drei Kindern. Auf diesem Weg macht er auch in einer Tagesklinik an seinem Wohnort Station und erlebt eine Rehaklinik von innen. Sein Erzählton wechselt von persönlich, herzlich und betroffen fließend zu ironisch und augenzwinkernd, bitterböse. Eben noch hat er sich mit Floskeln selbst Mut gemacht als ihn auch schon eine neue Panikwelle überflutet. Galgenhumor wechselt sich ab mit kostbaren Erkenntnissen, die er in seinem Tagebuch festgehalten hat. Diese ganze Palette eben von Angst und Unsicherheit, gepaart mit Hoffnung und dem Mut des Verzweifelten.
Zwar ging er die Sache mit dem Aufenthalt in pychiatrischen Einrichtungen sehr unbedarft an, dennoch kleben am Anfang viele Vorurteile an ihm, die er sich mit seinen persönlichen Erfahrungen teils bestätigt, teils aufhebt. Mich berührt, wie er die Kollegialität unter den Patientinnen und Patienten und ihre Natürlichkeit im Umgang miteinander und mit den eigenen Krankheiten seiner Abteilung erlebt.
Kritik am Ärzteapparat, an der Ressourcenknappheit, an Maßnahmen und Therapien und an der Betreuungsstrategie an sich kommt in eher leisen Tönen daher, teils pauschal, teils differenziert. Doch Hauck benennt auch die erfreulichen Seiten, insbesondere das Engagement der Betreuenden.
Alles in allem macht Uwe Hauck (Twitter: @bicyclist) Mut, sich selbst nicht aufzugeben. Ich schließe darum mit einer herzlichen Leseempfehlung und einigen Zitaten aus dem Buch.
Über die Depression:
Was immer man erlebt, wird erst durch einen Filter gejagt, das Positive entfernt, und was dann im Verstand ankommt, ist eine grauschwarze Melange von Trostlosigkeit und Katastrophenvorahnungen. Dazu noch diese Angst, dass eine der Katastrophen eintrifft, die man sich in aller Konsequenz ausmalt.
Man will ja nicht tot sein. Man möchte nur das Leben nicht mehr, das man zu dem Zeitpunkt führt.
Die Gedanken werden wieder zu Selbstläufern.
»Aber ich fühle mich gar nicht krank. Traurig, ja, aber so richtig krank nicht wirklich«, erwidere ich.
»Bist du aber, sehr schwer, fast todkrank.« Sie blickt mich an und nickt.
»Schon, aber wenn ich mir ansehe, was hier sonst zum Teil für Schicksale behandelt werden, dann geht es mir doch verdammt gut.«
@bicyclist Depression ist wie ein Gefängnis für gute Gedanken. Nur sind die guten Gedanken ausgesperrt. #notjustsad #ausderklapse
In mir rumort es, ich spüre, wie sich mein Magen verkrampft und meine Glieder kribbeln, als wollten sie einen Marathonlauf zurücklegen. Dieses Gefühl hasse ich, weil ich es nicht kontrollieren kann. Und weil ich dann nicht für meine Reaktionen garantieren kann. Erst als ich mit meinen Medikamenten befüllt im Bett liege, komme ich langsam runter und zu mir.
Über das Leben in der Klinik:
Überhaupt, das wirst du bald merken, sitzen hier keine Dummköpfe, die nix im Kopf haben, sondern lauter Leute, die eher zu viel im Kopf haben, zu viele Gedanken, Ängste, Sorgen, Traurigkeiten(, sagt ein Mitpatient.)
»Aber es gibt da draußen doch auch sogenannte normale Menschen, die keinen Dachschaden wie wir haben. Wie haben die das hinbekommen?«, fragt Laura.
»Na, die hatten zum Beispiel keine Scheißkindheit. Die haben nicht allen möglichen Mist ertragen müssen.« Zum ersten Mal merkt man Elke die versteckte Wut an.
Zusammenfassend sei gesagt …
»Kauen Sie auf einer scharfen Peperoni«, rät sie mir. Funktioniert, stelle ich mir aber mitten in einem Meeting im Büro durchaus lustig vor, genauso wie den Druck auf einen Schmerzpunkt an der Hand: Das daraus resultierende schmerzverzerrte Gesicht könnte falsch gedeutet werden.
Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen: Wenn ihr schwarze Gedanken habt, am Sinn eures Lebens zweifelt oder Panik und Angst euch immer wieder lähmt, sucht euch Hilfe. Ihr seid nicht schwach, wenn ihr euch Hilfe holt. Ihr seid klug und so mutig, eure Dämonen zu bekämpfen. Das ist ein Zeichen sehr großer Stärke.
Das alles wird mir nie wieder passieren, ganz sicher …
Hör auf, du lügst ja schon wieder.
@bicyclist Dein Leben ist ein Roman, für dessen Happy End du selbst verantwortlich bist.
 . Schädlich für mich war daran, dass ich mich mehrheitlich am Außen orientiert und andern mehr statt mir und meinem inneren Wissen geglaubt habe. Mir zu vertrauen gar nicht erst richtig probiert habe. Weil es mich, wann immer ich es doch getan hatte, ins pure Chaos führte. (Erst jetzt, hinterher, begreife ich all die Chancen, die im Chaos liegen und die ich selten genutzt habe … wobei … wer weiß das schon so genau?)
. Schädlich für mich war daran, dass ich mich mehrheitlich am Außen orientiert und andern mehr statt mir und meinem inneren Wissen geglaubt habe. Mir zu vertrauen gar nicht erst richtig probiert habe. Weil es mich, wann immer ich es doch getan hatte, ins pure Chaos führte. (Erst jetzt, hinterher, begreife ich all die Chancen, die im Chaos liegen und die ich selten genutzt habe … wobei … wer weiß das schon so genau?)