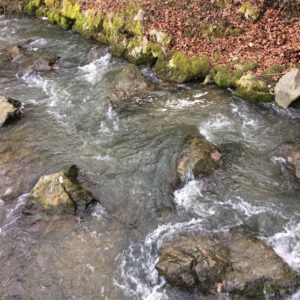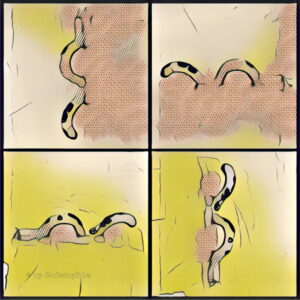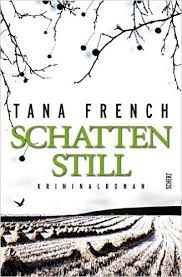»Entscheide du dich für eine Philosophie und richtest dein Leben danach aus oder suchst du dir eine Philosophie, die zu deinem Leben passt?«, fragte Kai gestern auf Twitter.
» Wie wäre es mit einer flexiblen Philosophie, die man dem eigenen Lebensweg immer wieder anpasst?«, fragte Irgendlink zurück.
»Es fängt viel früher an, mit Werten, mit Identifkation. Darum herum schneidert man sich seine Philosophie wie ein maßgeschneidertes Kleid«, schlug ich vor.
»Mir scheint, das ist mehr als alles andere einem Wandel unterworfen. (Außer die ethischen Grundwerte.)«, warf Frau Rebis ein.
»Welche Variante ist besser für mein Leben? Uff …«, fragte sich der Emil.
Ist das Konzept, das uns im Leben motiviert, womöglich ein Sowohl-als-auch-Ding, wie es Frau Traumspruch und Frau Rebis später zur Diskussion vorschlugen?
Wandeln sich die Werte oder wandelt sich ihre Glaubwürdigkeit? Oder wandelt sich unser Verhältnis zu unseren Werten? Und wie ist es mit den Fakten, auf die wir diese gründen? Wie wahr sind sie? Sind sie noch immer vertrauenswürdig? Nützen sie sich womöglich im Laufe der Zeit ab oder werden von anderen Fakten widerlegt? Wem können wir überhaupt noch vertrauen?
Genau darüber hat Christine Steiger in der neuen SPUREN-Ausgabe, Nr. 123, eine wunderbare Kolumne geschrieben. Wahre Fakten versus Fake News. (Und ja, das war soeben ein hemmungsloser Werbespot für diese tolle Zeitschrift!)
Vertraue ich mir? Vertraue ich dem, was ich zu wissen meine und für richtig halte? Warum glaube ich, dass das genau so richtig und wahr ist? Wer hat es mir gesagt? Welche Beweise brauche ich, woran halte ich mich fest?
Was ist mir wichtig und warum?
Schreiben. Weil es mir gut tut.
Und weil wir alle viel mehr das tun sollten, was uns gut tut. Wie es die schwedische Thrillerautorin Kristina Ohlsson in ihrem Nachwort zum grandiosen Thriller Papierjunge meisterhaft geschrieben hat (Link zum Nachwort). Und warum sie die Spirale durchbrochen hat, ausgestiegen ist, nur noch schreibt. Warum wohl? Ja. Weil es ihr gut tut.
Und ja, auch ich könnte zurzeit, rein theoretisch, jeden Tag schreiben. Weil es mir gut tut, mich erdet, mich zentriert. Ich könnte ganz viel schreiben. Stundenlang. Aber wie nannte es Milena Moser in ihrem letzten Blogartikel, Ein ziemlich guter Tag, gleich noch? Der Fluch der perfekten Bedingungen. Ja, das ist es vielleicht auch bei mir, wenn auch mit ein bisschen anderen Vorzeichen. Jetzt, wo ich könnte, weil ich zurzeit ja auf Stellensuche bin und darum gaaanz viel Zeit für mich habe, fallen mir immer wieder alle möglichen Gründe ein, nicht zu schreiben. Und das, obwohl ich schreiben will. Natürlich sind auch die Schmerzen in der Schulter, im Nacken und im Kopf, wenn ich zu lange an der Kiste sitze, ein Vorwand, es nicht zu tun. Oder aber ich arbeite weiter an der Trauer-Webseite, die ich mit anderen zusammen für andere verwaiste Eltern oder Geschwister gebaut habe. Viel Zeit und Herzblut habe ich schon in dieses Projekt investiert und mich gestern – aus Gründen wie Arztrechnungen und »Ich brauche unbedingt neue Turnschuhe« – sogar dazu durchgerungen, dort ein Spendenschweinchen einzurichten. Oder vielleicht auch aus dem Gedanken heraus: Ich gebe etwas in die Welt, also darf mir die Welt dafür etwas zurückgeben. Das Prinzip des Ausgleichens. So was in der Art.
Fakt ist, dass ich zwar Schriftstellerin bin, mich als Schriftstellerin fühle, mich als Schriftstellerin denke, aber davon nicht leben kann. Aus Gründen mangelnden Talents in Selbstvermarktung unter anderem. Und ja, auch Selbstzweifel sind ein Thema. Und ja, da beneide ich manchmal jene Menschen, die weniger gehemmt und weniger publikumsängstlich sind, die einfach hingehen und ihr Ding in den Raum stellen können. Sich vermarkten, ohne dass es nach Vermarktung stinkt.
Ausgerechnet in diese Gedanken hinein lese ich bei Luisa Francia über den Neid: »Neid ist die dunkle schwester des erfolgs. Sie kriecht überall hinein und verbreitet das schleichende gift. Warum hat die das und ich nicht? Warum kann sie sich das leisten und ich nicht? Warum hat die erfolg, die ist doch total blöd! Dabei ist neid eigentlich die therapeutin: schau hin. Das fehlt dir! Das willst du erreichen! Das ärgert dich!
Wenn eine/r etwas erreicht hat das fast nie damit zu tun, dass ein/e andere/r das nicht erreicht. Doch im kopf der neidischen person verbindet sich das. Die eigene enttäuschung, wut, der eigene mangel wird mit dem gelingen der anderen person verkoppelt. Das ist doch ungerecht! Und ja: diese welt ist nicht gerecht. Doch die beste möglichkeit diese ungerechtigkeit zu durchbrechen ist die entschlossenheit herauszufinden was wirklich fehlt, was erreicht werden soll und die mittel und wege zu finden, die da hin führen.«
Quelle: salamandra.de | luisa in one world – 28.03.2017 um 07:01:47
Ich schlucke leer und wünsche mir genau diese Hartnäckigkeit. Und diesen Mut. Und ja, ich wünsche mir langsam auch etwas, das ich bis vor kurzem nicht mal ohne Gänsehaut denken konnte: Erfolg. Gelingen. Auch in Form von endlich mal genug Geld auf dem Konto.
(Und schon will ich gleich wieder erklären, schon will ich nachschieben, dass das falsch klingen und falsch verstanden werden könnte, egoistisch zum Beispiel etc. …, aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen.)
Ah, meine massgeschneiderte Lebensphilosophie? Alles hängt miteinander zusammen. Darum denke und handle ich so liebevoll ich kann, lege da und dort ein paar gute Spuren aus, und mache möglichst wenig kaputt.