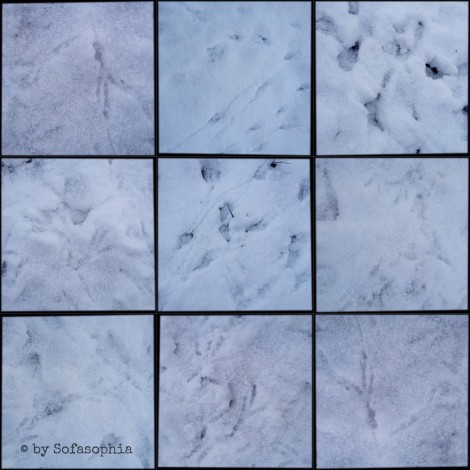Ich weiß, ein heikles Thema. Je nachdem, was wir erlebt haben, tut es weh, über Selbstbestimmung bis zuletzt, nachzudenken, doch ich kann grad nicht anders. In letzter Zeit habe ich mich so intensiv mit Tod und Sterben auseinandergesetzt, bei anderen darüber gelesen (bei Larapalara über das ewige Leben und warum es keine Option ist, zum Beispiel, oder bei Luisa Francia, die ihre betagte Mutter pflegt) sowie selbst darüber geschrieben.
Gerne teile ich hier ein paar meiner Gedanken.
#Triggerwarnung: Sterben, Tod, Sterbehilfe
+++
Den richtigen Tod. Ja, ich wünsche ihn mir. Das für mich richtige Sterben. Dass ich den Zeitpunkt spüre, wenn es für mich zu gehen heißt.
Wir alle haben wohl schon von jenen Natives gehört, Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern, die – wenn ihre Zeit gekommen ist – in die Wüste gehen und auf den Tod warten.
Wie könnte die Alternative, die Analogie dieses weisen Umgangs mit dem Tod in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft aussehen? In der Schweiz ist die aktive Sterbehilfe zum Glück weniger tabuisiert als in vielen anderen Ländern. Die passive Sterbehilfe gehört hier sogar längst zum Pflegealltag. Und dennoch haftet dem Thema – und wie ich meine zu Unrecht – etwas unmoralisches an. Menschen sollen sich nicht zu Gott machen und über Leben und Tod bestimmen, sagen die Gegnerinnen und Gegner unter anderem. Und dass mit solchen Möglichkeiten Druck auf alte Menschen ausgeübt werde. Mag sein, aber, ist es denn nicht auch ein Eingreifen ins göttliche Drehbuch, wenn jemand nur dank eines fremden Herzens, fremden Blutes oder dank eines Antibiotikums weiterlebt, wo er doch natürlicherweise (= gottgewollt) gestorben wäre? Was wissen wir schon wirklich über diese letzten Dinge?
Ich stelle es mir schön vor, eines Tages Abschied von meinen mir lieben Menschen zu nehmen, weil ich bewusst entschieden habe, dass ich genug gelebt habe. Bevor alle Gebrechen, die das Altwerden mit sich bringt, meine Lebensfreude und Lebenslust niederdrücken können. Frieden machen mit dem Leben, Frieden machen mit dem Tod. Und dann den Cocktail trinken. So stelle ich ihn mir vor, meinen richtigen Tod.
Ich kenne Menschen, deren Meinung mir lieb und teuer ist, die dennoch mit meinen Gedanken sehr hadern. Und ja, ich verstehe ihre Argumente. Wird meine Vision vom “richtigen Tod für alle” legalisiert, werden viele alte Menschen, die (böse ausgedrückt) nur Kosten verursachen, aber keine Leistungen mehr erbringen, nur noch mit einem schlechten Gewissen leben. Ganz besonders dann, wenn sie – anders als ich – keine selbstbestimmte Sterbeabsicht haben. Es könnte sie möglicherweise moralischer Druck einholen, ihnen oder ihren Nächsten und womöglich werden sie glauben, keine Daseinsberechtigung mehr zu haben. Ja, mag sein. Dennoch sollten wir als Gesellschaft lernen, über diese Thematik freier zu sprechen. Und vor allem soll der Wert jeden einzelnen Lebens nie in Frage gestellt werden. Ich spreche von wahrer Selbstbestimmung. Dazu gehört dann eben, dass jene, die den Cocktail wollen, ihn bekommen und jene, die ihn nicht wollen, keinerlei Druck haben dürften.
Schwierig, ich weiß, und ich habe nicht wirklich eine Ahnung davon, wie das gemacht werden kann.
Aber ich wünsche mir nicht nur für mich den richtigen Tod. Ich wünsche ihn mir für alle. Dazu gehört, dass wir das Tabu, das dem Tod anhaftet, überdenken. Unsere Angst vor der anderen Seite, die wir nicht kennen, ist natürlich und natürlich zutiefst menschlich. Immerhin geht es um die Endgültigkeit des Endes unseres irdischen Lebens. Da wir, im Gegensatz zu früheren Generationen, nicht mehr von einer in der Gesellschaft verankerten Religion aufgefangen werden, wird alles noch unfassbarer. Endloser, abgründiger. Da wartet auf die meisten von uns kein Himmel.
Nun ja, an den biblischen Himmel habe ich schon lange zu glauben aufgehört, nicht aber an etwas anderes, etwas Ewiges, Verbindendes, Inneres. Ich weiß nicht, ob es ist. Ob da etwas kommt. Ich weiß nur, dass ich in mir eine Ahnung habe, die alle meine Versuche, an nichts mehr glauben zu wollen, überlebt hat. Eine Ahnung, die von Ewigkeit und Liebe spricht.
Der Himmel und die Hölle sind in uns. Glaube ich. Alles ist in uns. Wieso sollte dann, wenn doch in allem, das ist, in allem das lebt, nicht – wie es uns das Wasser mit seinem Kreislauf und die Natur mit ihren Jahreszeiten lehren – etwas sein, das immer weiter geht? Über die Form, über die Gestalt mache ich mir keine Gedanken. Nicht mehr. Weil ich die Antwort nie kennen werde. Und weil es gut ist, nicht alles zu wissen.
Zu meiner Ahnung gehört auch, dass dasjenige, was dieses Alles ausmacht, viel größer ist, als das was wir sehen, glauben, erkennen, verstehen. Einfach deshalb, weil uns dazu die Sinne, die Rezeptoren fehlen, die verstehen könnten. Wir haben in uns (noch) keine Programme, die diese Wunder lesen und entschlüsseln können.
Könnten wir sie lesen, könnten wir sie entschlüsseln, wären es keine Wunder mehr, wäre alles klar. Und genau darum, so vermute ich, haben wir diese Programme nicht mitbekommen, vom Leben, von Wem-auch-immer. Um das Staunen nicht zu verlernen und die Demut. Möglicherweise werden diese uns fehlenden Rezeptoren im Laufe der Evolution des Menschengeschlechtes nach und nach entstehen? Möglicherweise.
Und möglicherweise ist alles ganz anderes als es je eine Prophetin, ein Lehrer, eine Spinnerin, ein Visionär, eine Magierin vorausgesagt hat?
Möglicherweise ist sogar der Tod etwas ganz anderes als wir denken.
Möglicherweise besteht der einzige Schreck des Todes darin, dass die Menschen, die weiterleben, es ohne den verstorbenen Menschen tun müssen.
Mit dieser Lücke.
Mit dem großen Fehlen.
Erfüllt von Leere bis zum Rand.
Das ist für mich der Fluch des Todes.
Das ist für mich das schier Unerträgliche.
Das, was ich nicht begreifen will.
Das, was mich immer wieder leiden lässt: Dass ich den geliebten Menschen nicht mehr berühren kann.
Verlust.
Für immer verloren.
Eine Amputation, die weit über Körperliches hinausgeht.
Die Seele wird angestochen.
Die Seele verliert ihren Halt.
Die Seele sackt in sich zusammen.
Leere, die bodenlos ist.
Schmerz, für den es nie Worte geben wird.
Ein Jetzt, das nie aufhört.
Eine Ewigkeit voll Nie.